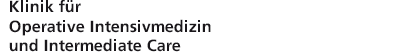Experimentelle & modellbasierte Forschung
Das Forschungslabor unserer Klinik befindet sich auf der 5.Etage und setzt sich aus mehreren Arbeitsgruppen zusammen. Jede einzelne Arbeitsgruppe umfasst ihr eigenes Themengebiet, sowie miteinander verzweigte Studien und Forschungsprojekte. Durch die enge Zusammenarbeit aus ärztlichem und wissenschaftlichem Personal können wir eine Vielzahl klinischer- und experimenteller Fragestellungen und Methoden vereinen und abdecken. Unsere Forschungsprojekte werden über verschiedene Mittel gefördert (z.B DFG, Start), wodurch wir auch eine große Anzahl an internen und externen Kooperationspartnern dazu gewinnen konnten. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir interne Meetings und Konferenzen, an denen die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse dargestellt und diskutiert werden.
Außerdem bieten wir Studierenden jederzeit die Möglichkeit Ihre Promotion in unserer Klinik, sowohl im klinischen als auch experimentellen Bereich zu absolvieren.